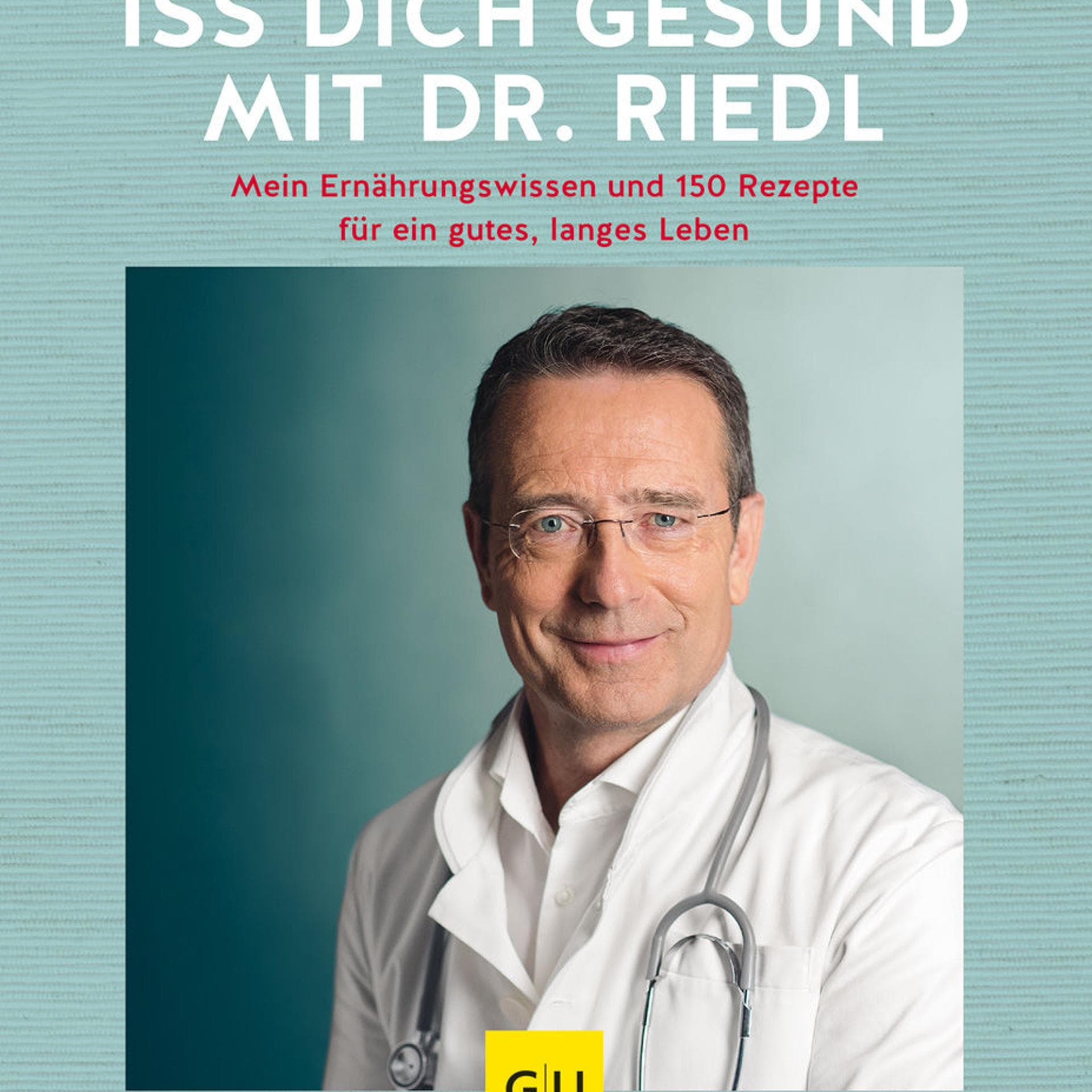Bestimmt haben auch Sie diese eine sehr spezielle, sehr wählerische Freundin in Ihrem Bekanntenkreis. Diejenige, mit der das Essengehen jedes Mal zum Hindernis-Parcours wird. Wenn Sie etwa nach einem Flohmarkt-Bummel zu zweit ein hübsches Café suchen: Alle Sonnen beschienenen Terrassen müssen Sie links liegen lassen, keine Markise, keine Menü-Tafel gefällt ihr. Stundenlang stolpern Sie durch die Gassen – um schließlich auf der schattigen Seite der Straße zu landen. In einem öden Laden, in den sich kein einziger ansehnlicher Mann verirrt hat. Und warum? Darum: „Sorry, ich vertrage Latte Macchiato nur, wenn er mit Soja-Milch zubereitet ist, und die gibt’s leider nicht überall.“ Nein, du Sonderwunsch-Ludmilla, denken Sie heimlich, Soja-Milch gibt’s wirklich nicht überall. Bis vor ein paar Jahren war Soja-Milch hierzulande sogar gänzlich unbekannt – und trotzdem tranken wir Kaffee, verdammt! Und selbst, wenn Sie sich dann endlich auf ein dröges, schattiges, aber bioenergetisch korrektes Lokal haben einigen können, nimmt der Terror kein Ende.
„Ich hätte gern den Sprossensalat mit Austernpilzen“, sagt die Freundin zur Bedienung. "Aber ohne Austernpilze. Und statt Bambussprossen hätte ich gern Radieschen. Und bitte Brot dazu. Aber ohne Mehl gebacken. Geht das?“ Eigentlich möchten Sie in solchen Momenten, geben Sie’s zu, allein aus Protest sofort eine Portion Pommes rot-weiß bestellen. Weil das einfach ist, schnell geht – und frei ist von komplizierten Botschaften und modischen Interpretationen. „Heiß und fettig“: welch herrlich übersichtliches Ernährungs-Prinzip! Die meisten kennen es aus der Kindheit.
Unser Essverhalten hat sich geändert
Andererseits: Würden Sie sich tatsächlich auch heute noch trauen, eine Speise der Sorte „schlicht und billig“ in aller Öffentlichkeit zu verzehren? Würden Sie es wagen, vor Ihrem Schwarm herzhaft in einen triefenden Burger zu beißen? Oder vor den Kollegen an einem Döner zu nagen? Würden Sie nicht vielleicht doch befürchten, dass man Sie für undiszipliniert, geschmacklos, ungebildet hält? Nie war es mit dem Essen so verteufelt schwierig wie heute, so scheint es. „Essen ist ein neues Tabu und eine soziale Herausforderung zugleich“, bestätigt Jens Lönneker vom Kölner Markt- und Medienforschungsinstitut Rheingold. Gemeinsam mit Sozialwissenschaftlern aus sieben Ländern hat der Diplom-Psychologe moderne Ernährungs-Gewohnheiten untersucht. Mit dem Ergebnis, dass unsere Ess-Stile sehr viel mehr über uns verraten, als uns lieb ist – oder, wie der Experte es ausdrückt: „Es kommt darauf an, was wir wann wie und mit wem zu uns nehmen. So etwas ist ein wesentlicher Bestandteil des Self-Modelling, des eigenen Images.“ Ernährung hat demnach kaum noch etwas mit dem Stillen von Hunger zu tun – aber sehr viel mit unserem Selbstbild, wie wir uns öffentlich inszenieren und wie andere uns dabei wahrnehmen. Der Teller wird zur Visitenkarte, nach dem Motto: „Zeige mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist.“ Gedanken um Body-Mass-Index, Diäten und Jojo-Effekt machen sich dabei leider immer noch vor allem die Frauen, sagt Lönneker. Männer dürfen bekanntermaßen „interessant“, Frauen müssen vor allem „schön“ sein. Und „schön“ sein bedeutet, zumindest in unseren Breitengraden, eben für die meisten Menschen „schlank“ sein.
Ess-Kultur
Viel interessanter als die Gewichtsfrage ist das Rollenspiel, das wir am Esstisch betreiben. Längst sprechen Fachleute nicht mehr nur vom bloßen „Körper-Kult“, sondern von einer „Erfolgs-Ästhetik“, die viel weiter gefasst ist. „Jemand, der perfekt mit asiatischen Essstäbchen umgeht, gilt als erfolgreicher und aufgeschlossener als jemand, der das Wok-Gericht mit Messer und Gabel verspeist“, sagt etwa Lönneker – und verweist auf TV-Shows wie das „Promi-Dinner“ als Beispiel für den „Event-Charakter“, den Essen heute für viele hat. Das Speisen in der Gemeinschaft wird zur Manege fürs Ego – auf die „Codes“ kommt es an. Ausgerechnet an einem schnöden Teigwickel erläutert Lönneker dieses „Event“-Prinzip: „Wenn Sie schwäbische Maultaschen zu Hause bei Ihrer Mutter verzehren, dann weckt das vielleicht Erinnerungen an die eigene Kindheit, eine wohlige Wärme stellt sich ein.“ Wer aber mit der urbanen Freundes-Clique einen Wochenend-Ausflug in einen rustikalen Gasthof mache, verspeise das gleiche Gericht dort vermutlich mit einem gewissen Augenzwinkern – als ironisches Zitat aus vergangenen Zeiten. Zeitgleich erlebt die zünftige Hausmannskost gerade einen Boom in den In-Restaurants von Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main. „Auch dort serviert man Maultaschen“, sagt Lönneker. „Hier allerdings in Miniatur-Format. Und plötzlich wird aus dem gleichen Lebensmittel wieder etwas ganz anderes. Wer es im In-Lokal verspeist, erweist sich als Szene-Kenner.“
Wie eng unser soziales Leben mit der Nahrungsaufnahme verknüpft ist – mit Rollenbildern, gesellschaftlichen Fantasien von Fortschritt oder Krisenangst –, zeigen auch die Historikerin Ingke Brodersen und der Völkerkundler Rüdiger Dammann in ihrem soeben erschienenen Buch „Mahlzeit. 60 Jahre Deutschland – eine kulinarische Zeitreise“ (Dumont, 24,95 Euro). Kein Zufall sei es, dass erste Fertiggerichte wie die berühmten Maggi-Ravioli aus der Dose im Jahr 1958 auf den Markt kamen – quasi zeitgleich mit Inkrafttreten des ersten Gleichberechtigungs-Gesetzes in der Bundesrepublik. „Wer weiß, wie weit wir mit der Gleichberechtigung der Frau heute wären, hätte die rot-gelbe Dose nicht die Fesselung der Frauen an den Herd gesprengt“, so die Autoren.

Heißhunger hat psychische Gründe
Unsere Essgewohnheiten haben mehr mit Psychologie zu tun als mit Biologie. Das haben auch amerikanische Wissenschaftler herausgefunden: Einer Studie des US-Fachmagazins „Appetite“ zufolge ist der Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel eng mit seelisch-emotionalen Faktoren wie „Belohnung“ oder „Bestrafung“, „Selbst- Disziplin“ oder „Versagen“ verknüpft. Und schon sind wir wieder bei „heiß und fettig“: Frauen, die ihre Lust auf Fast- Food mühsam unterdrücken, verputzen bis zu 50 Prozent mehr davon. Wer offen über sein Begehren nach Burgern & Co. spricht, schlägt nur halb so oft zu. Ähnliches kennen wir alle aus dem Supermarkt: Die Regale sind voll von Mikrowellen-Menüs der Sorte „Hackbraten mit Prinzess-Gemüse – fertig in zwei Minuten.“ Wer gibt schon zu, so etwas tatsächlich zu essen? Dabei kann so ein Gericht die Belohnung nach einem harten Arbeitstag sein: Königsberger Klopse aus der Dose schmecken in Jogginghosen in der privaten Höhle einfach besonders gut – statt eines Lagerfeuers flackert der Fernsehapparat dazu. In den USA werden solche „Schalen-Menüs“ gern als „TV-Dinner“ bezeichnet.
Essverhalten von Männern und Frauen
Übrigens greifen Männer und Frauen gleichermaßen zu Fertigware, betont der Psychologe. Einige kleine Unterschiede gäbe es allerdings schon. So seien unter dem Stichwort „Junggesellen-Chaos“ bei einigen Männern durchaus „Ansätze zu sozialer Verwahrlosung“ festzustellen, sagt Lönneker augenzwinkernd. „Manche löffeln das Zeug ungekocht aus der Dose. Das kommt in dieser Roheit bei Frauen wohl seltener vor. “Fest steht: Ein schlechtes Gewissen verdirbt nicht nur den Appetit, sondern womöglich auch noch das Selbstbild. „Jeder erlebt Phasen, in denen er entspannt und bewusst isst - und Stress-Zeiten, in denen er sich weniger vernünftig oder genusshaft ernährt“, sagt Lönneker.

Richtig Essen
Fazit der internationalen Studie: Wir sollten weniger von eindeutigen, fest gezimmerten „Ernährungs-Typen“ sprechen, als vielmehr von unterschiedlichen „Food-Verfassungen“ – die alle von uns einmal durchlaufen: die Lust auf „orale Masturbation“ (wenn wir Liebe brauchen), der Drang zum „PC Fuelling“ (wenn wir vor lauter Stress am Computer einen Keks nach dem anderen knabbern). Grämen Sie sich also nicht, ob Sie richtig „funktionieren“ – lassen Sie es einfach zu! Gesund ist, was schmeckt, pflegen gutmütige Großmütter zu sagen. In diesem Sinne: Guten Appetit!